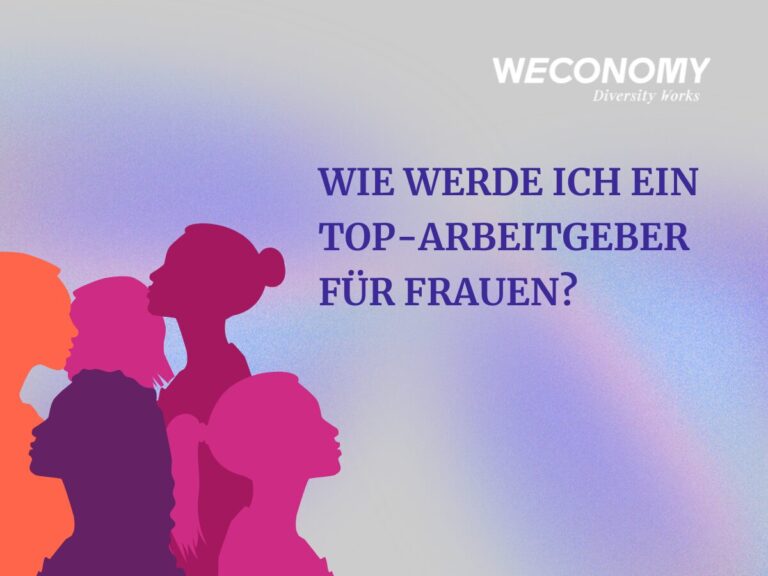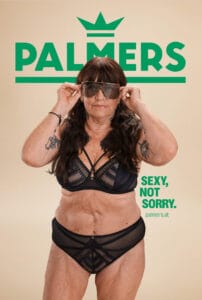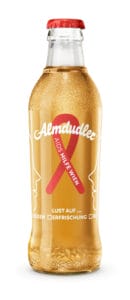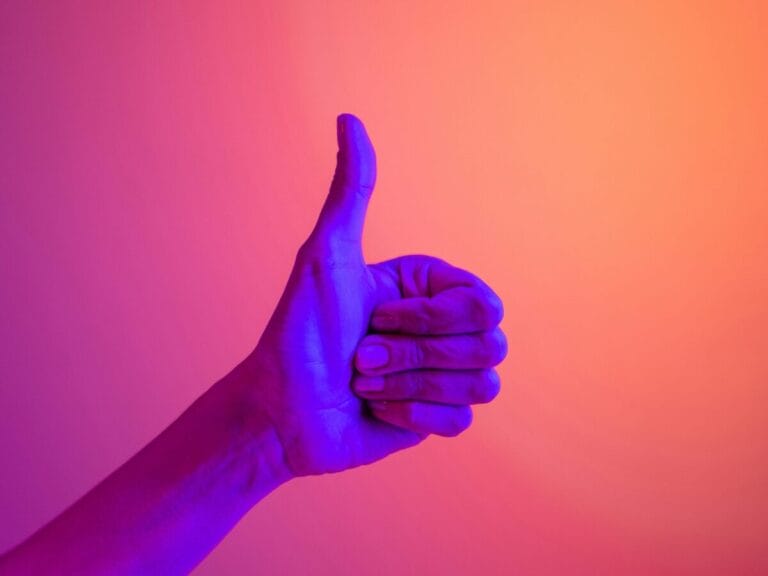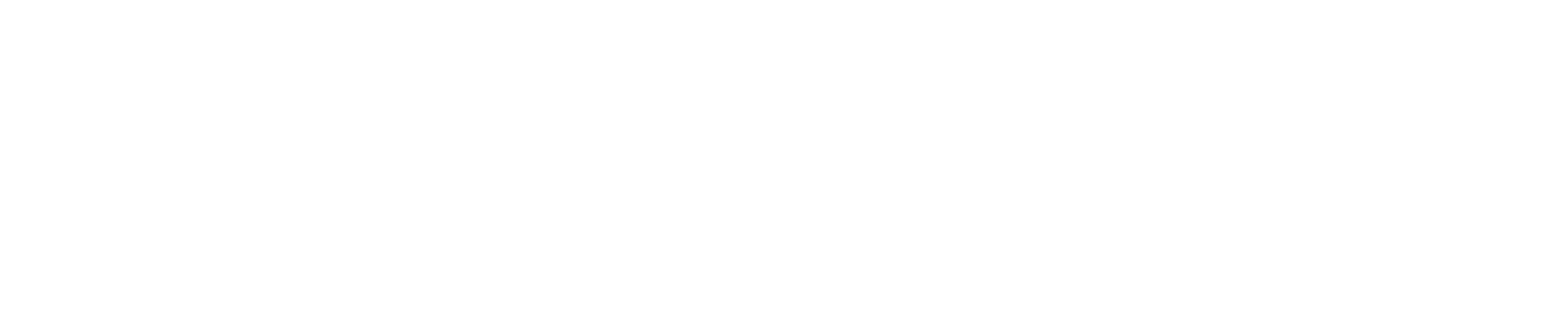Die Weltwirtschaft erlebt einen Diversity-Backlash. Während viele Unternehmen in den vergangenen Jahren auf Vielfalt gesetzt haben, kippt in manchen Organisationen die Stimmung. „Diversity? Das war gestern“, heißt es – oft nicht einmal mehr hinter vorgehaltener Hand. Dabei zeigen aktuelle Krisen und der sich verschärfende Fachkräftemangel: Unternehmen können es sich nicht leisten, auf Vielfalt zu verzichten – insbesondere auf die Potenziale migrantischer Lebensgeschichten.
Denn Herkunft prägt nicht nur den Menschen, sondern auch seine Führungsqualitäten. Doch das bleibt in vielen Organisationen unsichtbar. Grund genug für die weconomy Academy, bei der virtuellen lead&learn-Session am 11. Juni 2025 genau das in den Fokus zu stellen: Wie Herkunft zur Ressource wird – für Leadership, Teams und Unternehmenserfolg.
„Unsere Herkunft ist mehr als nur eine Geschichte im Lebenslauf. Sie prägt, wie wir denken, wie wir führen und wie wir mit Herausforderungen umgehen“, sagte Organisatiorin und Moderatorin Eszter zu Beginn. Rund 60 Teilnehmende aus HR, Führungsetagen und Diversity-Teams folgten der Einladung, Herkunft neu zu denken.
Herkunft als Kraftquelle: „Man kann sich selbst neu erfinden“
Ali Mahlodji, Unternehmer, EU-Jugendbotschafter und selbst Kind einer geflüchteten Familie, eröffnete die Session mit einem klaren Appell: „Ich wurde jahrelang nur als der Flüchtling gesehen – bis ich begriffen habe: Meine Geschichte ist kein Makel, sie ist mein größter Wettbewerbsvorteil.“ Seine Biografie, vom Flüchtlingskind zum erfolgreichen Gründer, mache ihn zu einem empathischeren Menschen und besseren Leader. „Wir müssen in der Arbeitswelt aufhören, nach perfekten Lebensläufen zu suchen. Wer Brüche in der Biografie hat, bringt wertvolle Kompetenzen mit – Resilienz, Improvisationstalent, Mut.“
„Wer sich selbst besser versteht, kann auch empathischer führen.“
Auch Lunia Hara, Expertin für empathische Führung, betonte: „Gerade Menschen mit Migrationsgeschichte führen komplexere Reflexionsprozesse durch. Ihre Herkunft zwingt sie, sich früh mit Identität auseinanderzusetzen.“ Für sie liege darin eine Stärke: „Wer sich selbst besser versteht, kann auch empathischer führen.“ Dabei rät Hara zur ehrlichen Auseinandersetzung: „Es reicht nicht, seine Stärken zu feiern. Auch Werte, die uns blockieren, müssen erkannt werden. Ich musste selbst erst lernen, dass Anpassung nicht immer der richtige Weg ist.“
Transformationsberaterin Begonia Vazquez Merayo fasste es so zusammen: „Internationalität und Vielfalt sind keine Extras. Sie gehören ins Zentrum jeder Unternehmenskultur. Die Herkunft eines Menschen ist wie Wasser für einen Fisch – sie bestimmt sein Denken, auch wenn wir es nicht immer merken.“
Unternehmenspraxis: Vielfalt sichtbar und nutzbar machen
Wie Unternehmen Herkunft zur Stärke machen können, zeigten Best Practices aus zwei Branchen:
McDonald’s Österreich setzt auf Sprachförderung. Karin Probst, Chief People Officer, präsentierte das Projekt „Sprachkurse MADE“: „Sprache ist der Schlüssel zu Selbstbestimmung – und zu beruflichem Wachstum.“ Mitarbeitende erhalten kostenlose, flexible Deutschkurse, kombiniert mit virtuellen Unterrichtseinheiten. Das Ziel: Barrieren abbauen, Integration fördern und Entwicklung ermöglichen. Über 400 Mitarbeitende haben das Angebot bereits genutzt. Das Ergebnis? „Mehr Selbstbewusstsein, mehr Austausch, mehr Zusammenhalt.“
Raiffeisenbank NÖ-Wien verfolgt einen strukturellen Ansatz. Personalentwicklungsleiter Thomas Holzer stellte die Diversity-Strategie vor, die Herkunft als eigenständige Dimension integriert: „Aktuell haben rund ein Drittel unserer Mitarbeitenden Migrationshintergrund – das ist eine Stärke, kein Risiko.“ Die Bank setzt auf Maßnahmen wie Sprachbuddies, interkulturelle Trainings und Corporate Volunteering mit Migrant*innen. Sichtbarkeit ist zentral: „Wir machen Mitarbeitende mit internationaler Biografie sichtbar – als Vorbilder für andere und als Beweis für unser Commitment.“
„Die Unternehmen, die jetzt Räume für Vielfalt schaffen, werden die sein, die in Zukunft erfolgreich sind.“
Wirtschaftlicher Imperativ: Diversity ist kein Nice-to-have
Dass Diversity aktuell als Kostenfaktor gesehen wird, kritisierte Ali Mahlodji scharf: „Das ist keine Frage von Social Impact, sondern von Wirtschaftlichkeit. Unternehmen, die Herkunft und Biografie der Mitarbeitenden anerkennen, sichern sich die Führungskräfte von morgen.“
Begonia Vazquez Merayo sieht darin sogar eine Überlebensfrage: „Die Unternehmen, die jetzt Räume für Vielfalt schaffen, werden die sein, die in Zukunft erfolgreich sind. Es ist eine Entscheidung: Investiere ich in Menschen oder verliere ich sie?“
Lunia Hara ergänzte: „Empathische Führung ist der Schlüssel, um diese Potenziale zu halten. Mitarbeitende gehen heute nicht mehr wegen des Gehalts – sondern wegen schlechter Führung.“
Fazit: Herkunft anerkennen, Vielfalt gestalten
Die lead&learn-Session zeigte klar: Herkunft und kulturelle Vielfalt sind Ressourcen, die Unternehmen strategisch nutzen sollten. Nicht aus Imagegründen, sondern weil sie Innovationskraft, Resilienz und Teamzusammenhalt fördern. Der Appell der Speaker*innen war eindeutig: Unternehmen müssen Herkunft sichtbar machen – und Vielfalt konsequent gestalten.
Die Weconomy Academy
2025 hat die weconomy Academy gestartet und hebt lead&learn auf das nächste Level. Ein zentrales neues Format sind die virtuellen Masterclasses, die quartalsweise stattfinden. Sie bieten Raum für den Austausch zu aktuellen DEI-Themen, spannenden Impulsen und erfolgreichen Best Practice Beispielen. Begleitet werden die Masterclasses von renommierten Expert*innen aus der weconomy Jury, die ihre Expertise und Erfahrung einbringen.